Psychologisches Wissen: Positives Denken, Positivismus, Positivistische Persönlichkeit, positive Kommunikation
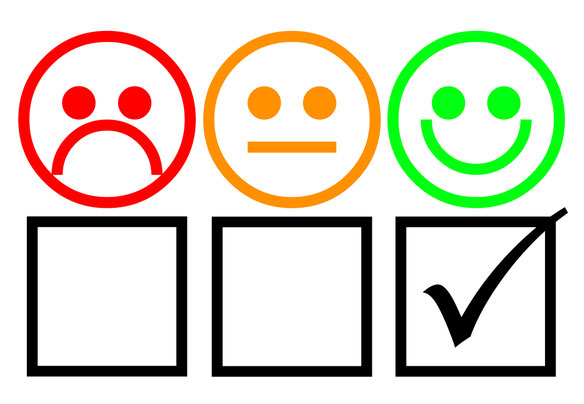
Einführung
Das Gegenteil von negativem Denken ist positives Denken, das Gegenteil von Negativismus ist Positivismus und das Gegenteil von negativistischen Persönlichkeiten sind positivistische
Persönlichkeiten.
Positivistische Persönlichkeiten zeichnen sich durch eine positive Grundhaltung gegenüber anderen Menschen aus. Sie interpretieren Umweltreize und Informationen durchweg positiv, selbst jene, die objektiv nicht zwingend positiv sind.
Abgrenzung von Naivität
Selbst negativen Informationen und Nachweisen verleiht die positivistische Persönlichkeit einen positiven Sinn. Damit gilt die durchweg positivistische Grundhaltung als Übergang zur naiven Persönlichkeit, wobei sie deutlich von ihr abzugrenzen ist. Die Integration vermeintlich hilfsbedürftiger Menschen ist für positivistische Persönlichkeiten ebenso ein zentrales Thema wie bei naiven Persönlichkeiten. Hier gibt es eine deutliche Überschneidung.
Da es auch weitere Ähnlichkeiten zwischen beiden Persönlichkeiten gibt, können diese in der Regel leicht verwechselt werden. Die Übergänge sind fließend. Ein Unterschied besteht jedoch hinsichtlich der Ausprägung der Naivität – auch sind keine aggressiven Tendenzen in eine sehr parteiische polarisierende Richtung (gut-böse / schwarz-weiß) bekannt. Die positivistische Persönlichkeit sieht alles gleich positiv und urteilt weniger polarisierend.
Positivistisch sein, bedeutet nicht automatisch, dass das Verhalten positivistischer Persönlichkeit das genaue Gegenteil des typischen Verhaltens negativistischer Persönlichkeiten darstellt. Dennoch passen einige Aspekte in diese Richtung.
Verhalten positivistischer Persönlichkeiten:
- Befolgung von Vorgaben anstelle deren Missachtung,
- positive Mimik und einladende Gestik in der sozialen Interaktion z.B. in Kommunikationssituationen,
- Zustimmen statt ständiges Hinterfragen unrelevanter oder unwesentlicher Zusammenhänge,
- Äußerung des Glücks und Wohlgefühls anstelle häufiger Äußerung von Unwohlgefühl im sozialen Kontext,
- Umdeutung von persönlichem Unglück oder Schmerzen anstelle von häufigem Klagen darüber,
- Streben nach Verbreitung positiver Stimmung an Stelle von häufigem "Sich beschweren" oder Provozieren von Streit,
- Positive Reaktion auf unterschiedliche Reize anstelle heftiger Reaktionen auf bereits kleinste Reize,
- Aktives Zuhören anstelle von Weghören oder Gesprächsstörern,
- Kommunikativ gedeutete Annahme nützlicher Vorschläge statt aktiver Ablehnung und Weghören,
- Aktivität statt Passivität und Vermeidungsverhalten,
- Spontanität statt Verzögerungsmanöver,
- Unterstützung der Bemühungen anderer,
- Kooperation statt vorsätzlicher Nicht-Kooperation usw.
Problematik
Das prinzipielle positive Auftreten und Dafür sein kann Menschen aus dem Umfeld jedoch stark irritieren, insbesondere jene Menschen, deren Persönlichkeit durch ungünstige bis negative Einflüsse geprägt ist. Häufig geäußertes Lob anderer – auch das extreme Understatement mit der Betonung, dass andere gewiss alles besser können als man selbst, kann andere mittelfristig stark irritieren und sogar stören.
Positivistische Persönlichkeiten werden oft als angepasste „Ja“-Sager bezeichnet. Häufig schlägt ihnen völliges Unverständnis sowie Neid und Groll gegenüber - Gefühle, welche sie selbst nicht zu kennen scheinen.
Da eine kritische und z.T. negativistische Grundhaltungen in Deutschland in vielerlei Hinsicht teilweise fast schon gesellschaftskonform ist (siehe z.B. extrem kritische und häufig negative Presseberichterstattung insbesondere in Bezug auf herausragend erfolgreiche Persönlichkeiten, Unternehmen und Institutionen, extremes Beschwerdeverhalten, messbare gerichtliche Streitlust, Antrieb, andere ggf. zu verklagen, häufige Androhung einer Klage, Schnelles Drohen mit Anwalt, Abmahnwellen, Überlastung der Gerichte, Beharren auf Rechten, starkes Aufbegehren gegen Benachteiligung und Diskriminierung etc.), werden positivistische Menschen häufig belächelt und wenig ernst genommen.
Positivismus zählt zu den gesellschaftlich weniger akzeptierten Mentalitäten als die negativistische Persönlichkeitsstörung. Dies zeigt sich auch in entsprechenden Entscheidungen (z.B. Personalentscheidungen) und weiteren betriebswirtschaftlichen Entscheidungsprozessen, in denen durchweg positivistische Persönlichkeiten sich nur schwer durchsetzen können.
Was ist Positivismus?
Die Namensgebung für den Begriff „Positivismus“ selbst geht u.a. auf Auguste Comte (1798–1857) zurück. Positivismus ist zugleich ein humanistischer Ansatz und für manche Menschen eine Art Religionsersatz.
Positivistische Menschen stellen häufig Mitgefühl und Altruismus ins Zentrum ihres Lebens und sehen beides zugleich als zentrales Ideal für das gesellschaftliche Zusammenleben an, in dem allen Menschen, selbst Verbrechern positiv und mit offenen Armen entgegengetreten wird.
Während Deutschland ein Land mit weniger positivistischen Menschen ist (dafür aber mehr naiv-aggressive Persönlichkeiten) ist Positivismus insbesondere in Brasilien deutlich stärker vertreten. Der Positivismus erreichte hier sogar einen deutlichen Einfluss auf Politik, Gesellschaft und Sozialleben. Es gibt dort sogar eine „Positivistische Gemeinde Brasiliens“ in der ein regelrechter Kult in dieser Richtung betrieben wird.
Positivismus hat nicht nur einen religiösen Einfluss, sondern auch einen Einfluss auf die Linguistik und die Psychotherapie. In beidem spielt die sprachliche Deutung und Umdeutung eine wichtige Rolle.
Positivismus spielt ebenfalls eine Rolle in Bezug auf das Gesetz der Anziehung, das neben der Aussage „Gleiches zieht Gleiches an“ u.a. auch besagt: Positives zieht Positives an. Dies gilt auch in der Methodik der „Kreativen Visualisierung“, wobei ebenfalls „Dankbarkeit“ als positives Element eine wichtige Rolle spielt.
Im gesellschaftlichen Leben und gesellschaftspolitischen Kontext stellt Positivismus jedoch eine eingeschränkte Sicht auf die Welt dar, die ggf. auch zu einem Schaden für sich selbst führen kann. Positivistische Persönlichkeiten haben jedoch die Neigung bzw. „Fähigkeit“, einen solchen Schaden nicht als Schaden zu betrachten und ihm sogar etwas Positives abgewinnen. Was auf der einen Seite (im Hinblick auf Methodik) eine regelrechte Fähigkeit darstellt, gilt – je nach Blickwinkel - auf der anderen Seite als Störung
Positives Denken
Positives Denken kann auf charakterlichem Positivismus beruhen oder als Denk-Methode genutzt werden. Als Denk-Methode wird positives Denken auch auch als „neues Denken“, „richtiges Denken“, „Kraftdenken“ oder "mentaler Positivismus" bezeichnet. Ebenso wird positives Denken zum Zwecke des positiven Verhaltens bzw. der positiven Kommunikation genutzt.
Bei positivem Denken als Denk-Methode wird beabsichtigt, das eigene bewusste Denken mit Hilfe von Achtsamkeit in Bezug auf Gefühls- und Denkprozesse und positiver Kommunikation sowie mit Hilfe von Affirmationen, positiven Glaubenssätzen und Visualisierungen) ins Positive zu steuern, um über eine optimistische, konstruktive und zielführende Grundhaltung eine höhere Zufriedenheit, Zielerreichung, Gesundheit und Lebensqualität zu erzielen und sich das Leben damit möglichst einfach zu machen.
Beim positiven Denken nimmt der Glaube bzw. das Glauben bzw. "Für wahr halten" an sich - sowie entsprechende Erwartungen - eine zentrale Stellung ein. Dazu zählt der Glaube an die Wirksamkeit des Glaubens, der Glaube an die eigene Selbstwirksamkeit oder der Glaube an das Positive, an Gott, an die Macht des Universums usw.
Während Kritiker des positiven Denkens positives Denken als naiv und Weltfremd erachten und eher negative Folgen wie die Verdrängung der Realität bis hin zum Realitätsverlust (bei unkritischen Menschen) befürchten, nutzen Befürworter und Verfechter des positiven Denkens diese Methodik, um ihr Leben selbst aktiv zum Positiven zu gestalten und manifestieren mit Hilfe des positiven Denkens in Kombination mit anderen Techniken genau das in ihrem Leben, was kritische, pessimistische und negativ denkende Menschen anzweifeln.
Während Kritiker behaupten, das positives Denken nicht auf psychologischer Wissenschaft basiere, sondern sich um "esoterische Ratgebergebilde" handele, sieht die Wissenschaft selbst hingegen anders. Dass der Glaube daran, die Dinge, die ein Mensch für „wahr“ hält, die Tendenz haben, sich im Leben zu verwirklichen, funktioniert, erklären diverse bekannte psychologische Theorien und Konzepte (z.B. das psychologische Selbstwirksamkeitskonzept nach A. Bandura oder das Konzept der Selbsterfüllenden Prophezeiung).
Aus der Psychologie ist bekannt, dass bestimmte Erwartungen sowie das Maß dieser Erwartungen die Tendenz und Ausprägung der entsprechenden Wahrnehmung beeinflussen, die sich auf das jeweils Erwartete übertragen - und damit auch auf die Erwartungs-Erfüllung.
Darüber hinaus gibt es aber auch physikalische und spirituelle Theorien und Konzepte, an die man glaubt - oder eben nicht. Letztendlich schafft sich jeder Mensch durch sein eigenes Denken eine eigene Wirklichkeit. Ob diese Wirklichkeit nun positiv ist oder negativ hängt von der jeweiligen Denkweise ab, die wiederum das entsprechende Verhalten (positiv, aktiv, mutig und zielführend oder eben negativ, abwartend, passiv, gehemmt und konstruktiv) maßgeblich beeinflusst.
Achte auf Deine Gedanken, denn sie werden Deine Worte!
Achte auf Deine Worte, denn sie werden Deine Taten!
Achte auf Deine Taten, denn sie werden Deine Gewohnheit!
Achte auf Deine Gewohnheiten, denn sie werden Dein Charakter!
Achte auf Deinen Charakter, denn er wird Dein Schicksal!
(aus dem jüdischen Talmud)
Das Glück Deines Lebens hängt von der Beschaffenheit Deiner Gedanken ab
(Marc Aurel)
Das, was du heute denkst, wirst du morgen sein
(Buddha)
Mein Erleben ist das, worauf ich mich entschieden habe, meine Aufmerksamkeit zu richten
(William James)
Die größte Entscheidung deines Lebens liegt darin, dass du dein Leben ändern kannst,
indem du deine Geisteshaltung änderst
(Albert Schweitzer)
Tatsächlich kennt man aber auch geradewegs zwanghaft aufgesetztes Positives Denken, das wie eine Art der Religion vollzogen wird. Auch gibt es Glaubensgemeinschaft, die zwanghaft positives Denken auf ihrer Agenda haben. Ein solcher Zwangsoptimismus hat jedoch nichts mit einem berechtigten gesunden Optimismus zu tun, dessen positiven Nutzen aufgrund des umfangreichen Wissens darüber und entsprechender Erfahrungswerte niemand berechtigt abstreiten kann und wird.
Positives Denken durch positive Kommunikation
Positive Kommunikation durch positives Denken
Es besteht ein Zusammenhang zwischen positivem Denken und positivem Verhalten z.B. positiver Kommunikaton. Umgekehrt beeinflusst
unser Denken unser Verhalten bzw. unsere Kommunikation.
Positive Kommunikation bedeutet, dass durch achtsame sensible Wortwahl und positiv formulierte Sätze und Wörter eine empathische, respektvolle und gleichzeitig selbstsichere Kommunikation geschaffen wird. Denn pauschalisierende Wörter wie "immer", "nie" oder "grundsätzlich" führen ebenso zu inneren und äußeren Konflikten wie manche Vergangenheits-Formulierungen, Stacheldrahtformulierungen und Killerphrasen.
Eine achtsame, positive Kommunikation schafft Sympathien und erhöht Respekt und Anerkennung bei anderen. Da Gedanken und Sprache zusammenhängen, steigert dies auch unsere Authentizität in Form der Übereinstimmung zwischen dem, was wir denken, fühlen und zeigen bzw. sagen.
Ist das Glas "halb leer" oder "halb voll"? Im Prinzip ist es das Gleiche. Doch die eine Formulierung erzeugt negative Bilder, Stimmungen und Gefühle, während die andere Formulierung ein positiveres Bild und Gefühl vermittelt, sowohl anderen Menschen als auch sich selbst gegenüber. Schließlich fördert positive Kommunikation wiederum positives Denken. Die Formulierung "Ich habe erst drei Stunden gearbeitet" stimmt negativ, während "Ich habe bereits die Hälfte der Arbeit erledigt" hingegen motiviert.
"Das weiß ich nicht. Ich muss die Kollegen fragen." wirkt desinteressiert und inkompetent. Der Satz "Ich informiere mich gern für Sie, einen Moment." hat dagegen eine positive Wirkung und zeigt persönliches Engagement. Der Satz "Die Nachspeise war eine Katastrophe" wirkt vernichtend. Ich kann stattdessen aber auch sagen: "Das Schnitzel (Hauptgericht) war super". Den Rest mit der Kritik lasse ich (vorerst) weg. Denn wer wirklich offen für Kritik ist, wird schon fragen. Und sollte dies der Fall sein, dann kann ich auch die Wahrheit positiv formulieren.
Die Formulierung eines verärgerten Chefs, der zum Beispiel sagt: „Mich stört, nervt und ärgert Ihre Unpünktlichkeit“ löst nun mal andere Bilder und Emotionen aus, als zum Beispiel die Formulierung: „Da für mich Pünktlichkeit ein sehr hoher Wert ist, würde mir die Zusammenarbeit mit dir noch mehr Spaß machen, wenn du dich an unsere zeitlichen Absprachen hältst.“.
"Sie kommen schon wieder zu spät" klingt vorwurfsvoll und bewirkt das Gegenteil von dem, was eigentlich ihr Ziel ist. Anders klingt es wenn ich sage: "Es ist schön für uns alle, wenn Sie pünktlich sind und wir nicht warten müssen". Was zu sagen war, wurde gesagt. Punkt. Während positive Kommunikation zu Verstehen und Verständnis sowie zu Erfolgen und Zielerreichung führt, führt negative Kommunikation zu aversiven Stimulationen und damit zu Unverständnis, Ärger, inneren und äußeren Konflikten und Misserfolgen.
Es ist ein Unterschied, ob ich sage: "Du bist zu faul oder zu dumm zu lesen" bzw. "Wer lesen kann, ist deutlich im Vorteil" oder ob ich sage: "Mir scheint, als bist du ggf. noch nicht dazu gekommen, dieses oder jenes konkret durchzulesen". "Das klappt sowieso wieder nicht" oder eine Stufe darunter „Ich bin nicht sicher, ob das klappt“ hat eine andere Wirkung wie „Das wird sicher klappen.“ Denn wer bereits mit seiner Sprache Pessimismus verbreitet, läuft geradewegs in eine Gedankenfalle und zieht andere mit dort hinein. "Das wird schon klappen" klingt gewiss erst einmal etwas naiv. Doch wichtiger ist: Unser Gegenüber geht zuversichtlich und mit der Erwartung eines Erfolgs an eine Sache heran.
"Von 12 bis 14 Uhr empfangen wir keine Kunden" drückt eine negative Haltung gegenüber Kunden aus. "Wir sind von 8 bis 12 Uhr und von 14 bis 18 Uhr für Sie da", klingt hingegen anders. Wir müssen nicht krampfhaft "positiv" formulieren wie ein Motivations-Guru. Doch es ist trotzdem ein deutlicher Unterschied, ob das Glas "halb leer" oder "halb voll" ist. Die Haltung ist eine andere - und damit das, was diese Grundhaltung bei uns selbst und bei anderen bewirkt.
"Ich weiß nicht, wie das geht, ich habe keine Ahnung" zeigt ein anderes Engagement und einen anderen Intellekt als wenn Sie sagen: "Klingt interessant und spannend. Ich werde mich informieren und setze mich dann wieder mit Ihnen in Verbindung, um Ihnen optimal weiterzuhelfen".
Dies bezieht sich auch auf Kritik, die man sich mit positiver Kommunikation keineswegs unterdrücken muss: "Ihr Vortrag war total langweilig und extrem verkrampft. Die Inhalte kamen so gar nicht rüber" führt keinesfalls zu einer Verbesserung - und erst recht nicht zu einer Motivation zu eben solcher. Wenn man aber sagt: "Mit ein klein wenig mehr Körpersprache können Sie Ihre super interessanten Inhalte noch mehr zur Geltung bringen", macht sich der andere dann auch wirklich Gedanken, interessiert sich und fragt ggf. noch. Der nächste Vortrag wird sicher besser.
